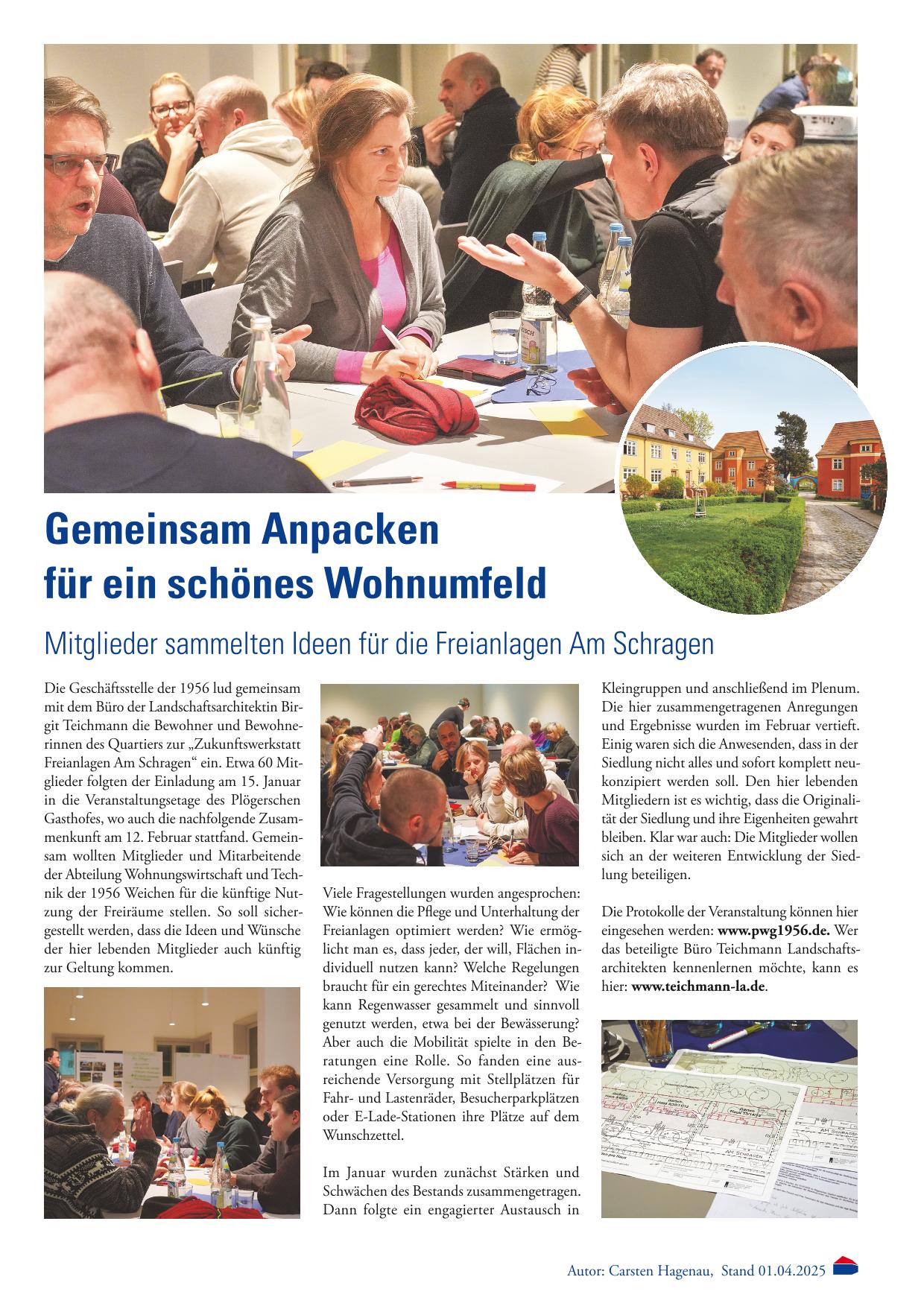News
der PWG 1956

PWG 1956 und das Kunsthaus sans titre feiern am 30. August den Sommer
Das Kunsthaus sans titre in der Französischen Straße ist ein fester Bestandteil der Potsdamer Kulturszene – facettenreich, inspirierend, unverwechselbar. Die PWG 1956 unterstützt das Kunsthaus seit Langem und lädt ihre Mitglieder und Kulturbegeisterte am 30. August 2025 herzlich ein, diesen besonderen Ort gemeinsam zu feiern: mit Musik, Kunst und jeder Menge Sommerlaune.

Zum diesjährigen Genossenschaftstag am 18. Juni traten gut 100 Fans in die Pedale, um bei einer Radtour die Highlights der 130 Jahre zählenden Historie der Genossenschaften zu besichtigen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Genossenschaftsforum, dem auch die PWG 1956 angehört. An den Stationen der Tour hatten auch die Vertreter unserer Genossenschaft Interessantes zu bieten.

Zusatztermin am 26. September im Plögerschen Gasthof
Der erste Termin war in kürzester Zeit ausgebucht – deshalb freuen wir uns, einen Zusatztermin für unseren besonderen Filmabend anbieten zu können!
Am Freitag, den 26. September 2025, laden wir Sie herzlich ein zu einem exklusiven Kinoabend im Plögerschen Gasthof in Potsdam. Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Die aktuelle Ausgabe unseres Mitgliedermagazins „Information der Genossenschaft“ ist erschienen und steht ganz im Zeichen der diesjährigen Vertreterversammlung der PWG 1956.
Erfahren Sie mehr über die wichtigen Ergebnisse, die dort vorgestellt wurden: Klaus-Peter Ohme vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen würdigte unsere Genossenschaft als gesund, finanzstark und zukunftsfähig – mit besonderem Engagement für kommende Generationen.

Klaus-Peter Ohme, der die 1956 seit 35 Jahren als Prüfer begleitet und wie kaum ein anderer deren besonders erfolgreiche und auch komplizierte Abschnitte miterlebt hat, ist sich sicher: Bei der Vorsorge für die Zukunft und die kommenden Generationen unterscheidet sich die 1956 deutlich von vielen anderen Genossenschaften.
Am 30. Juni trat die Vertreterversammlung der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 im Potsdamer Kongresshotel zusammen. Bei satten Sommertemperaturen war die Nähe zum Templiner See verführerisch. Aber die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der 1956 hatten wichtigeres zu tun, ist doch die turnusmäßige Vertreterversammlung das höchste Gremium der Genossenschaft. Und, wenn man so will, das wichtigste Ereignis des Jahres im Leben einer Genossenschaft.

Studierende entwickeln frische Ideen für die 1956
Zwölf Studierende der Berliner Media University of Applied Sciences haben sich im Rahmen eines Semesterprojektes mit der 1956 befasst. Sie hatten die Aufgabe, Vorschläge zu unterbreiten, wie junge Mitglieder der Genossenschaft für eine ehrenamtliche Tätigkeit als gewählte Vertreter begeistert werden können.
Es entstanden drei sehr unterschiedliche Konzepte für eine Werbekampagne, die von den Studierenden Mitte Juni dem Vorstand vorgestellt wurden.

Der Potsdamer Genossenschaftstag erkundet wichtige Stationen mit dem Drahtesel
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Potsdamer Genossenschaftstag unterwegs mit dem Fahrrad durch die Stadt.
Die Vereinten Nationen (UNO) haben 2025 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen. Unter dem Motto „Cooperatives Build a Better World“ soll die Bedeutung von Genossenschaften weltweit gewürdigt und ihre Rolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen gestärkt werden.

Süßer Genuss in der Anna-Zielenziger-Straße: Das Café Franz überzeugt mit eigenen Kaffee- und Kuchenkreationen
Französische Kultur soll im Café Franz gelebt werden. Das neue französische Bistro in der Anna-Zielenziger-Straße 1 hat die 37-jährige Vanessa Franz gemeinsam mit ihrem Vater Christian Schild Ende April eröffnet. Ab 8.30 Uhr duftet es täglich nach frischem, eigens für das Café kreierten Kaffee und selbstgemachten Kuchen.

Ein Hauch von Glamour in der Anna-Zielenziger-Straße:
Die „Art & Sip Lounge“ öffnet als erste gastronomische Einrichtung in den neuen Gewerberäumen in Potsdams Mitte
Die Kombination von Kunst und Genuss haben sich die Inhaber der „Art & Sip Lounge“ auf die Fahne geschrieben. Seit dem 24. April öffnen Claudia Goldschmidt und Laszlo Böttger immer mittwochs bis sonntags ab 13 Uhr ihre Tür der stilvoll eingerichteten Bar in der Anna-Zielenziger-Straße 3.

Potsdams soziale Wohnungswirtschaft steht für bezahlbaren Wohnraum, Stabilität und sozialen Zusammenhalt in ihren Wohngebieten auch in Zeiten der Wenden und Krisen.
Der diesjährige Sommerempfang des Arbeitskreises StadtSpuren stellte diese Werte in den Mittelpunkt.
Mit fast 200 Teilnehmenden aus Stadtpolitik, Stadtverwaltung, Verbänden, Vereinen und Initiativen wurde am 20. Mai im Treffpunkt Freizeit der Sommerempfang der sozialen Wohnungswirtschaft in Potsdam begangen.

Auf der 1956-Geschäftsstelle tut sich etwas: eine Photovoltaik-Anlage wird auf dem Dach errichtet
Erstaunlich, wie viel Neugier ein Gebäude weckt, das plötzlich hinter einem Gerüst verschwindet. Aktuell verhüllt ein Baugerüst seit etwa vier Wochen die Fassade an unserer Geschäftsstelle in der Zeppelinstraße 152.

Ausstellung von Christine Jackob-Marks im Kunsthaus sans titre
Ab dem 10. Mai zeigt das Kunsthaus sans titre in Potsdam die beeindruckende Ausstellung „Kosmos“ der renommierten Künstlerin Christine Jackob-Marks. Die Vernissage findet am Freitag, den 10. Mai, um 18 Uhr in der Französischen Straße 18 statt. Bis zum 22. Juni können Besucherinnen und Besucher die Werke jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr entdecken.

Martin Lehmann und seine „Linksfüßer“ veranstalten den Potsdamer Galaball. Die PWG 1956 ist Kooperationspartner.
Lehmann tanzt bereits seit seiner Jugend und ist ausgebildeter Turniertänzer – ein Profi. Kurz nach seinem Umzug nach Potsdam Ende 2003, gründete der gebürtige Cottbusser seine Tanzschule „Die Linksfüßer“. Die ersten Kurse wurden noch in Gaststätten gegeben. Seit 2006 sind Lehmann und sein Team im Logenhaus in der Kurfürstenstraße zu Hause. Daneben gibt es noch eine kleine Filiale in der Posthofstraße.
Arne Huhn, Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Personelle Änderung im Vorstand und der Geschäftsführung
Im Namen des gesamten Aufsichtsrates freue ich mich mitteilen zu können, dass wir den strukturierten Prozess zur Vorstandsnachfolge planmäßig beginnen konnten.
Die Landeshauptstadt Potsdam hat am 1. Januar dieses Jahres eine neue Wertstofftonne eingeführt – die Gelbe Tonne Plus. Damit sollen mehr Abfälle als bislang recycelt werden.
Mit der neuen Wertstofftonne möchte die Landeshauptstadt die Mülltrennung vereinfachen. Bislang durften in der Gelben Tonne ausschließlich Verpackungen entsorgt werden, seit Januar sind nun auch andere Abfälle gleichen Materials erlaubt – sogenannte „stoffgleiche Nichtverpackungen“. Gemeint sind damit Abfälle aus den Materialen Kunststoff, Weißblech, Aluminium oder Verbundstoff. Bislang mussten diese in den Tonnen für Restabfall entsorgt werden.

Die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 wurde für ihre Bautätigkeit im Block III erneut ausgezeichnet: Von den Mitgliedern des Vereins Stadtbild Deutschland e. V. wurde der wiederauferstandene Plögersche Gasthof in der Anna-Zielenziger-Straße 7 zum „Gebäude des Jahres 2024“ gewählt. Mit der Übergabe der Ehrenplakette wurde die Auszeichnung heute gemeinsam mit den Vertretern des Vereins, des Vorstandes der PWG 1956 sowie des Architekten gewürdigt.

Die 1956 feiert ein besonderes Jubiläum: Seit zwei Jahren ist sie erfolgreich auf Instagram und Facebook vertreten.
Über diese digitalen Plattformen versorgt die Wohnungsgenossenschaft ihre Mitglieder und Interessierte mit Neuigkeiten, spanenden Hintergrundberichten, Veranstaltungsankündigungen und vielen weiteren Servicethemen.

Mit Käse & Wein Veranstaltungsetage eingeweiht
Die alljährlichen Herbsttreffen der gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 fanden am 26. und 27. November statt, diesmal im Plögerschen Gasthof. Die beiden Zusammenkünfte waren die ersten Veranstaltungen an dieser Adresse. Das Interesse war groß, die Zustimmung ebenso.
An beiden Abenden waren die künftigen Veranstaltungsräume des Plögerschen Gasthofes gut besucht. Mehr als vierzig gewählte Vertreter versammelten sich am Montag, ebenso viele am Dienstagabend.

Die 1956 konnte Mitte November eine besondere Ehrung entgegennehmen: Das von der Genossenschaft errichtete Gebäude Am Alten Markt 3 wurde als zweitschönstes Gebäude des Jahres 2023 ausgezeichnet. Vertreter des Vereins Stadtbild Deutschland e.V. übergaben der Genossenschaft 1956 eine Ehrenplakette, die im Eingangsbereich des Hauses angebracht wurde. Mit seinem Preis will der Verein auf wertvolle Beiträge zur Baukultur aufmerksam machen.